„Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparate benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben.“ Diesem Diktum des evangelischen Theologieprofessors Rudolf Bultmann, das aus den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts stammt, scheint bis heute eine Mehrheit der Menschen zuzustimmen. An Wunder zu glauben, so meinen viele Zeitgenossen, ist für einen aufgeklärten Menschen nicht möglich.
Da die meisten Menschen und insbesondere die Oberstufenschüler unser Gymnasien nicht als weltabgewandte Fundamentalisten gesehen werden wollen, betrachten sie die biblischen Wundergeschichten als Texte, die, weil sie dem Weltbild der modernen Naturwissenschaften widersprechen, als fiktiv angesehen werden müssen. Worum es in diesen Texten geht, nehmen die Jugendlichen meist überhaupt nicht wahr, da sie meinen, den biblischen Autoren durch ihr physikalisches, biochemisches und medizinisches Grundwissen überlegen zu sein. So ist es nicht verwunderlich, dass empirische Studien der jüngeren Zeit gezeigt haben, dass die Vorstellung eines wundertätigen, machtvoll in die Welt eingreifenden Gottes für Heranwachsende an Relevanz verliert.Ich meine, dass Jugendlichen, wenn sie der biblischen Überlieferung mit einer solchen Haltung begegnen, der Zugang zu wesentlichen Glaubenseinsichten verwehrt bleibt. Der christliche Glaube ist ganz fundamental von der Hoffnung bestimmt, dass Gott seine Welt anders haben möchte, als sie ist, und dass er verheißt, die leidvollen Zustände in der Welt ändern zu können (vgl. Röm 8,19-23) – auch gegen das, was Menschen aufgrund ihrer Alltagserfahrung erwarten. Den Heranwachsenden müssten daher im Religionsunterricht Denkansätze aufgezeigt werden, durch die ihnen einsichtig wird, dass die biblischen Wundererzählungen keine obsoleten Texte sind, sondern auch für Christen heute Brisanz und Bedeutung haben.
Im Folgenden werden einige Schritte eines Lernwegs vorgestellt, der dies ermöglichen soll. Im Blick sind dabei insbesondere Oberstufenschüler – junge Erwachsene, die ganz genau wissen, dass das Leben naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten gehorcht und von denen daher viele der Idee zuneigen, die biblischen Wundergeschichten als Märchen abzutun.
Es geht bei den didaktischen Anregungen, die ich vorstellen möchte, nicht darum, das Phänomen „Wunder“ kognitiv handhabbar zu machen – dazu sehe ich mich nicht imstande. Das bescheidene Ziel besteht hingegen darin, dazu beizutragen, dass die Frage nach der Aussage und der Relevanz der biblischen Wundergeschichten bei den Jugendlichen offen gehalten wird, und Schritte auf dieses Ziel hin zu bedenken.
Schritt 1: Neugierde wecken
Das zentrale Problem im Umgang Jugendlicher mit den biblischen Wundergeschichten, das Religionslehrkräfte angehen müssen, ist, dass die Heranwachsenden den Texten in der Regel ohne jedes Interesse begegnen. Denn während die Beispielgeschichten Jesu, zumindest dann, wenn sie entsprechend präsentiert werden, durch ihren ethischen Aufforderungscharakter zu provozieren vermögen, während die Gleichnisse durch ihre Bildersprache ästhetisch involvieren können, während die Geschichten des Alten Testaments durch ihre anschauliche äußere Handlung Spannung erzeugen, sind die Wundergeschichten, die in der Bibel erzählt werden, für viele Jugendliche nur ein für sie inzwischen uninteressantes Relikt aus der Kindheit. Längst nämlich haben sie gelernt, dass Menschen nicht auf dem Wasser gehen können, dass sich Wasser nie und nimmer in Wein verwandeln kann und dass Blinde nicht sehend, Lahme nicht gehend und Tote nicht lebendig werden können. Die Texte der Bibel, in denen solches erzählt wird, werden daher von den meisten Jugendlichen entweder als bewusste Manipulationsversuche von Jesus-Anhängern oder naive Augenzeugenberichte ohne Realitätsbezug abgetan.
Wer die Texte angemessen begreifen will, muss sich jedoch von einem grundsätzlichen Missverständnis frei machen, das spätestens seit der Aufklärung die Gemüter zu beherrschen droht: der Ansicht, dass der moderne und postmoderne Mensch dem antiken an Einsichten grundlegend überlegen sei. In der Tat hat die Menschheit in den Jahrhunderten und Jahrtausenden seit der Entstehung der biblischen Wundertexte entscheidende neue wissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen. Doch wäre es nicht naiv von uns Heutigen anzunehmen, dass die antiken Autoren und ihre Leser bzw. Zuhörer nicht gewusst hätten, dass es unmöglich ist, auf dem Wasser zu gehen, dass die unbezwingbar scheinenden Mauern Jerichos nicht durch Trompeten zum Einsturz gebracht werden können, dass nicht drei Millionen Israeliten durch ein plötzlich trockenes Meer marschieren können? „Spannend und auch für uns weiterführend wird es,“ so der Alttestamentler Ernst Otto, „wenn wir den Autoren die gleiche Vernunft unterstellen, die wir für uns in Anspruch nehmen.“3
Erst wenn man den Jugendlichen dies einsichtig gemacht hat, werden sie den Antrieb verspüren herauszufinden, was die Intention der antiken Autoren war, als sie solche Geschichten aufschrieben.
Vorschlag zur Methodik
Die Lehrkraft zeigt den Schülerinnen und Schülern Bilder von berühmten Wissenschaftlern, Autoren, Denkern, Staatsmännern und Entdeckern – und zwar in umgekehrter chronologischer Reihenfolge ihrer Lebenszeit. Dabei ist das Unterrichtsgespräch auf die kognitiven Leistungen der Personen zu lenken. Den Jugendlichen soll im Zuge des Gesprächs deutlich werden, dass auch Personen, die schon vor hunderten von Jahren lebten, großartige gedankliche Leistungen vollbracht haben.
Die Jugendlichen dürfen anschließend ein Ranking bezüglich der Intelligenz der gezeigten Berühmtheiten bilden. Dabei werden auch Menschen, die vor langer Zeit lebten, auf den ersten Plätzen landen, etwa Platon, Leonardo da Vinci oder Leibniz.
Das Unterrichtsgespräch sollte nun darauf zugespitzt werden, dass die Menschen früher offensichtlich nicht dümmer waren als wir heute. Provokativ kann die Lehrkraft nun eines der genannten Beispiele für naiv scheinende Texte aus der Bibel heranziehen und die Klasse darüber diskutieren lassen, wie es sein kann, dass solche Texte aufgeschrieben und überliefert wurden.
Am Ende dieses Unterrichtsbausteins muss keine Antwort stehen, sondern es sollte eine Fragehaltung entstanden sein.
Schritt 2: Neue Sichtweisen auf die Realität eröffnen
Menschen heute wenden gegen die biblischen Wundergeschichten ein, dass sie im Widerspruch zur empirisch erfahrbaren Realität stehen. Alles, was als wirklich gelten soll, muss sich vor dem modernen Menschen als empiriekonform ausweisen, auch abstrakte religiöse Ideen. Diese Vorstellung ist jedoch jüngeren Datums. Für die antiken Autoren stellt sich das Verhältnis genau umgekehrt dar: Nicht die empirische Erfahrbarkeit, sondern die theologische Richtigkeit einer Idee verbürgt deren Wahrheit; und sollte die empirische Erfahrung auf anderes hindeuten, zieht dies nicht die Idee, sondern unsere empirische Wahrnehmung in Zweifel.
Eine solche Denkart ist uns Heutigen fremd. Und doch ist es eine spannende Herausforderung, die hier an uns gestellt wird: Vielleicht müssen wir, um der eigentlichen Realität ansichtig zu werden, tiefer schauen, als die empirische Wahrnehmung unserer Augen es zulässt. Vielleicht müssen wir den Mut haben, darauf zu vertrauen, dass unsere religiösen Ansichten richtig sein können, auch wenn sie empirischen Erfahrungen widerstreiten, dass die empirischen Erfahrungen vielleicht erst irgendwann in naher oder ferner Zukunft der religiösen Idee folgen werden. Vielleicht bleibt uns nichts als die Hoffnung, dass die Empirie zwar manchmal trostlos scheint, aber Gott gegen allen Augenschein irgendwann einmal neue empirische Realitäten schaffen wird, die mit der jetzt bereits richtigen religiösen Idee übereinstimmen.
Vorschlag zur Methodik
Für diese Gedanken könnten die Schülerinnen und Schüler anhand einer an Bilder anknüpfenden Reflexion aufgeschlossen werden. So könnte beispielsweise zunächst eine Zeichnung oder eine Landkarte betrachtet werden, auf der der Zion, aber auch der Ölberg Jerusalems zu sehen ist. Schon auf den ersten Blick werden die Schülerinnen und Schülerfeststellen, dass der Ölberg höher ist als der Gottesberg. Auch die Information, dass für die Menschen der Antike der Zion als der höchste Berg galt, da er der Gottesberg war, wird sie nicht von ihrem empiriegeleiteten Urteil abbringen. Sehr bewusst sollte die Lehrkraft den Gegensatz zwischen empirisch erfahrener Realität und Idee kontrastieren und möglichst an der Tafel festhalten.
Ins Nachdenken werden die Jugendlichen aber dann kommen, wenn man ihnen andere Bilder aus ihrer eigenen Erfahrungswelt zeigt, in denen empirisch erfahrene Realität und Idee auseinanderklaffen. Denkbar wäre beispielsweise eine Fotografie von zwei Menschen, die gleichgültig nebeneinander sitzen. Zunächst sollten die Schülerinnen und Schüler das Bild beschreiben, damit sichergestellt werden kann, dass sie die nach außen hin erkennbaren Gefühle der beiden abgebildeten Personen richtig erfassen. Nun gibt der Lehrer der Klasse die Information, dass es sich um ein Pärchen handelt, dass sich von Herzen liebt. Die Schüler werden irritiert sein, werden aber schnell einsehen, dass sie diese Behauptung des Lehrers aus der Fotografie heraus nicht widerlegen können. Damit ist der Boden bereitet für die Erkenntnis, dass empirische Erfahrung nicht das Maß aller Dinge sein kann, wenn es darum geht, die Wahrheit zu erfassen.
Auch andere Beispiele könnten herangezogen werden. Den Schülern leicht einsichtig zu machen ist beispielsweise die Subjektivität bei der Zeitempfindung. Die Uhr mag immer eine Zeitdauer von fünf Sekunden angeben – aber ist der lebensgefährliche Absturz eines Menschen aus schwindelnder Höhe nicht länger als beispielsweise ein Moment des Lachens? Oder scheint er nur länger? Was ist der richtige Maßstab? Unser persönlicher Eindruck oder die Zeiteinheiten der Uhr?
In Klassen, die im philosophischen Denken geübt sind, sollte man das Beispiel der Mathematik heranziehen, um den Schülern deutlich zu machen, dass es sich bei der Präferenz für den Wissensgehalt der Idee nicht um einen vorwissenschaftlichen und insofern geringerwertigen Erkenntnisweg handelt. Die Mathematik arbeitet völlig empiriefrei. Dies kann man den Schülern ganz einfach damit verdeutlichen, dass man die Rechnung 1+1=2 an die Tafel schreibt. 1 und 1 ist in empirischer Hinsicht niemals 2, sondern allenfalls 11. Als Ergebnis die 2 anzunehmen, setzt voraus, dass ich von der empirischen Erfahrung abstrahiere und die beiden addierten Gegenstände nicht mehr jeweils für sich wahrnehme. Damit aber stelle ich die Idee über die Empirie.
Nach solchen Überlegungen sollte man im Unterricht auf das Eingangsbeispiel, die unterschiedlich hohen Berge, zurückkommen. Nach wie vor ist der Ölberg der empirisch höhere; dies wird und soll keiner der Schülerinnen und Schüler bezweifeln. Doch sie sollten an diesem Punkt des Unterrichts begriffen haben, dass den biblischen Autoren der empirische Eindruck aus guten Gründen nicht das Maß aller Dinge war. Für uns heute ist die Empirie der oberste Maßstab; auch religiöse Vorstellungen lassen wir nur dann als richtig gelten, wenn sie mit unseren empirischen Erfahrungen übereinstimmen. Die Menschen der Antike gehen umgekehrt von religiösen Erfahrungen aus und rechnen damit, dass die empirischen Erfahrungen diesen folgen und sich ihnen unterordnen werden.5 Die neuzeitlich-moderne Frage, ob denn Wunder mit Naturgesetzen überhaupt vereinbar seien, ist für biblische antike Autoren daher kein wirklich bedrängendes Problem, nicht zuletzt deswegen, weil der Antike die Vorstellung von „Naturgesetzen“ unbekannt ist. Wenn eine theologische Erkenntnis zutreffend ist, hat dies Vorrang vor unserer empirischen Weltwahrnehmung.
Diese Sicht der Dinge kann uns veranlassen, die starr dichotomische Einteilung von potentiellen Geschehnissen in die Kategorien „möglich“ und „unmöglich“ zu überdenken. Freilich ist es nach dem Analogieprinzip unwahrscheinlich, dass Jesus wirklich Wasser in Wein verwandelt haben, auf dem Wasser gewandelt sein, ja Tote auferweckt haben soll. Aber sollte das Analogieprinzip wirklich über möglich und unmöglich entscheiden dürfen? Kann Gott nicht auch Dinge geschehen lassen, die den von Menschen beschriebenen Gesetzmäßigkeiten des Weltverlaufs widersprechen? Sollten unsere empirischen Erfahrungen in Sachen Gott das letzte Wort sein? Oder kann ab und an auch etwas geschehen, was dem (vielleicht nur vermeintlich) naturgesetzlich-regelhaften Weltverlauf widerspricht, weil Gott will, dass es geschieht?
Schritt 3: Die Bibel als Erfahrungsbericht lesen
Die Abneigung mancher Heranwachsender gegen ein Ernstnehmen biblischer Texte resultiert auch daraus, dass sie bei den Rezeptionsmöglichkeiten von einer falschen Alternative ausgehen: Die Erzählungen müssen entweder buchstäblich wahr sein, nämlich exakt so geschehen, wie es geschrieben steht, oder es handelt sich um wertlose Erfindungen.
Den Jugendlichen fehlt die Einsicht, dass es sich bei der Bibel um eine Sammlung von von Menschen geschriebenen Texten handelt, in denen sie etwas von ihrem persönlichen Glauben erzählen. Natürlich ist dieser Glaube durch konkrete Erlebnisse geprägt. Und doch werden diese Erlebnisse niemals neutral berichtet, sondern sind durch die subjektive Wahrnehmung des Erzählers geprägt.
Vorschlag zur Methode
Damit die Schülerinnen und Schüler dies begreifen – und diese Erkenntnis ist für den Umgang mit jedwedem biblischen Text wichtig – könnte beispielsweise exemplarisch mit synoptischen Bibeltexten gearbeitet werden, in denen gleiche oder ähnliche Ereignisse erzählt werden, die sich aber in wichtigen Details voneinander unterscheiden. Man denke hier beispielsweise an die verschiedenen Speisungswunder, an einen Vergleich unterschiedlicher Seewandelgeschichten, eventuell sogar an die verschiedenen Auferstehungsgeschichten.
Wenn im Unterricht solche scheinbar widersprüchliche Bibeltexte gelesen werden, kommt die Religionslehrkraft regelmäßig in Legitimationszwänge: Lügt der biblische Autor uns hier an? An diesem Punkt sollten die Schülerinnen und Schüler dafür sensibilisiert werden, dass Ereignisse nie neutral berichtet werden können, sondern jede Erzählung ein deutendes Subjekt voraussetzt. Die Differenz zwischen bloßer Faktenschilderung und persönlicher Darstellung von Ereignissen, die in ihrem eigenen Leben von Bedeutung sind, könnte ihnen auch einen neuen Zugang zu biblischen Texten ermöglichen.
Beim Vergleich der unterschiedlichen synoptischen Darstellung des gleichen Wunders können die Schülerinnen und Schüler überlegen, welche Ereignisse den unterschiedlichen Erzählungen zugrunde liegen könnten. Hierdurch wird ihnen die Differenz zwischen faktischem Ereignis und menschlicher Deutung deutlich bewusst werden. Im Unterrichtsgespräch sollten nun die Gedanken der Lernenden auf die Frage gelenkt werden, ob eine solche Deutung der Ereignisse legitim ist.
Gewinnbringend dürfte im Besonderen sein, wenn die Erkenntnisse des letzten Lernschritts auch für diesen fruchtbar gemacht werden können. Bei den biblischen Wundergeschichten lässt sich die empirische von der religiösen Wirklichkeit oftmals gut trennen.
Bei der Geschichte von der Errettung der Israeliten am Schilfmeer besteht die dahinter stehende religiöse Idee, die in der Erzählung ihren Ausdruck findet, darin, dass Gott so mächtig ist, dass er die Israeliten aus der Sklaverei befreien kann. Was aber ist die dahinter stehende empirische Wahrheit? Mithilfe einfacher wissenschaftlicher Literatur können die Schülerinnen und Schüler sich die empirische Realität leicht selbst erschließen. Sie sah wohl so aus, dass einige wenige Menschen unter unwahrscheinlichen Bedingungen tatsächlich aus der Knechtschaft frei kamen. Mit Gott hat dies aus dieser Sicht – wenn man in empirischen Kategorien denkt – nichts zu tun.
Die Aufgabe besteht nun darin, darüber nachzudenken, was die Wahrheit ist. Die nüchterne empirische Bestandsaufnahme oder die deutende Darstellung der biblischen Autoren?
Schritt 4: Für Ungewöhnliches offen werden
Nach heutigem Stand der wissenschaftlichen Forschung bestehen wenig Zweifel daran, dass Jesus tatsächlich heilerische Fähigkeiten hatte.6 Den aufgeklärten Gymnasiasten ist dieser Gedanke in der Regel äußerst sperrig. Sie haben – erfreulicherweise! – zumeist begriffen, dass man mit Berichten von angeblichen wundersamen Kräften, wie sie in den Medien immer wieder begegnen, kritisch umgehen muss. Zu oft werden Menschen aus finanziellen Interessen falsche Hoffnungen und haltlose Versprechungen gemacht. Einen kritischen Umgang mit solchen Phänomenen zu pflegen, bedeutet aber – so der ursprüngliche Wortsinn des Adjektivs kritisch – die Möglichkeit von Wunderheilungen nicht pauschal auszuschließen, sondern sorgfältig zwischen Scharlatanerie und echten Fähigkeiten zu unterscheiden.
Vorschlag zur Methodik
Über die Möglichkeit von Wunderheilungen nachzudenken, kann in der Unterrichtspraxis am besten anhand aktueller Berichte von medizinischen Sensationen geschehen – ein Unterrichtsgegenstand, an dem in der Regel auch Schülerinnen und Schüler Interesse zeigen, die biblischen Themen mit Desinteresse begegnen. Sie sollen sich, am besten in Form selbsttätiger Arbeit, auch über mögliche wissenschaftliche Erklärungen solcher Heilungswunder informieren. Meist werden sie auf psychologische Mechanismen zurückgeführt, die an den Einfluss bestimmter Personen gebunden sind, sodass die Rede von einem Heilungscharisma nicht unangebracht ist.
Als nächster Schritt wäre ein Vergleich mit der Heilungstätigkeit Jesu anzustellen. Auch hier halte ich die eigenständige Textarbeit der Schülerinnen und Schüler mit anschließenden Impulsreferaten für die am besten geeignete Methode. So nämlich haben sie nicht das Gefühl, eine subjektive Meinung vorgegeben zu bekommen, sondern können sich aus wissenschaftlichen Fakten selbst ein Bild machen.7 Wenn auf die sich anschließenden Impulsreferate zu den Arbeitsergebnissen eine Diskussion folgt, werden verbleibende Zweifel zudem offener angesprochen werden, als wenn die Lehrkraft den Unterricht leitet. Am Ende dieser Unterrichtseinheit sollte die Erkenntnis stehen, dass nicht nur das unkritische Für-wahr-Halten von Sensationsmeldungen, sondern auch eine euphorische Überhöhung des derzeitigen medizinischen Wissensstands naiv wäre.
Schritt 5: Sich auf die Aussagen der Wundertexte einlassen
Durch die bisher vorgestellten Lernschritte kann erreicht werden, dass die Jugendlichen die in der Bibel überlieferten Wunder überhaupt erst mit Aufmerksamkeit lesen und nicht sofort als bedeutungslos abtun. Der entscheidende Schritt aber fehlt noch: aus der neutralen Akzeptanz soll persönliche Involviertheit entstehen. Die Schülerinnen und Schüler sollen entdecken, dass die Texte mit ihnen persönlich zu tun haben. Aber haben sie das? Die biblischen Wundergeschichten erzählen von Menschen in höchster Bedrängnis, in Krankheit, Angst und Entbehrung; sie sind von Einsamkeit und Tod bedroht.
Dennoch aber können diese Texte nicht nur den Blinden und Lahmen der Antike etwas sagen, sondern auch Jugendlichen der Gegenwart.
Alle jungen Menschen müssen in ihrem Leben Begrenzungen erfahren. Ich denke hierbei an Heranwachsende, denen die soziale Anerkennung fehlt, an die vielen Schülerinnen und Schüler, die für sich keine Zukunftsperspektiven sehen, an die, die an Lebensproblemen im schulischen oder privaten Bereich schier zu verzweifeln drohen. Im Zuge des Älterwerdens stoßen alle Kinder und Jugendlichen immer wieder – viel mehr, als es den Erwachsenen zumeist bewusst ist – an die Grenzen dessen, was sie selbst leisten können. Immer wieder kommen sie an Punkte, wo sie aus eigener Kraft nicht weiterkommen können. Sie nehmen an sich selbst – und an anderen Menschen im Nah- (oder medial vermittelten) Fernbereich – vielfach Erfahrungen von Begrenzungen und Verengungen des Lebens, der Lebensmöglichkeiten und der Wirklichkeit wahr: Da sind die Erfahrungen des Nicht-Könnens, der Ohnmacht, des Zu-kurz-Kommens, da sind Behinderungen psychischer Art, da ist das Sterben vor der Zeit. Wir können dies alles als eine Grunderfahrung prinzipiell jeden menschlichen Lebens, vor allem aber auch kindlichen und jugendlichen Lebens und Erlebens bezeichnen.
In dieser Situation kann Heranwachsenden der Glaube helfen, dass es einen Gott gibt, dem ihr Schicksal nicht gleichgültig ist und der ihrem Leben eine Wendung geben kann. Für Wundergeschichten ist es unter diesem Blickwinkel entscheidend, dass sie gegen die Angst angehen und Hoffnung stiften. Material erzählen sie von Lebensfülle und von einer Wirklichkeit, die zeichenhaft-symbolisch schon jetzt spürbar ist und dann in Gottes Zukunft vollendet wird. Hier wird eine Zukunft verheißen, die nicht mehr unter Entbehrungen, Entstellungen, Dekonstruktionen und Bedrohungen leidet. Thematisch geht es in den Wundergeschichten um die Überwindung von Lebens- und Wirklichkeitsbegrenzungen bzw. -einschränkungen unterschiedlicher Art und damit um gutes, gelingendes Leben in einer gottgemäßen, schalomförmigen Wirklichkeit. Indem sie zeigen, wie kranke, gefährdete und kaputte Existenzen heil werden und Menschen ihr Leben wieder leben können, verheißen und inszenieren sie „Lebensgewinn“.8 Sie machen Gottes Schalom-Willen sinnenfällig erfahrbar und zeigen seine Welt-, Lebens- und Menschenfreundlichkeit. Diese betrifft die ganze Schöpfung und alle Facetten des Menschen, seinen Leib wie seinen Geist. Die Wundergeschichten zeigen und formulieren so Wirklichkeitsvorstellungen und Dimensionen guten und gelingenden Lebens, die wir brauchen, wenn und weil wir uns nicht abfinden wollen mit den gegebenen Einschränkungen des Lebens und der Wirklichkeit.
In den Wundergeschichten wird unsere unheile Welt als heilbar vorgestellt. Sie zeigen, dass die Wirklichkeit „über die Grenzen des Menschenmöglichen“ hinaus9 veränderbar ist.
Vorschlag zur Methodik
Das Potential der Wundergeschichten liegt darin, dass die Jugendlichen durch sie erahnen können, wie groß die Macht und der Liebeswille Gottes ist. Um dies zu entdecken, müssen sie sich voll und ganz auf die Texte einlassen. Lehrkräfte können (und werden) nicht verlangen, dass alle ihre Schülerinnen und Schüler ihre naturwissenschaftlichen Denkkategorien ein für alle Mal ablegen und die Wundergeschichten kritiklos für geschehen halten. Aber sie können die Jugendlichen vielleicht motivieren, sich auf ein Gedankenexperiment einzulassen: nämlich einfach einmal auszuprobieren, wie es denn wäre, wenn die Texte wahr sein sollten.
Sehr gut erreichbar ist dies durch Spielszenen, insbesondere deshalb, weil der gezeichnete Lernweg zu den Wundern – ganz so wie der Religionsunterricht in der Oberstufe wohl generell – eher kognitiv ausgerichtet war.
Für das Spiel verbinden sich die Schüler gegenseitig die Augen, um ein Gespür dafür zu bekommen, was es heißt, blind zu sein. Wichtig ist, dass diese Erfahrung nicht vorschnell abgebrochen wird, da die Schwierigkeiten, die ohne die Fähigkeit zu sehen entstehen, erst nach geraumer Zeit und beim Ausüben verschiedener Tätigkeiten deutlich spürbar werden. Ideal wäre es, wenn die Schüler im blinden Zustand gewöhnlichen Alltagstätigkeiten nachgehen könnten (beispielsweise in die Pause gehen; sich etwas zu essen kaufen; wieder zum Klassenzimmer finden), wofür aber eine hohe Bereitschaft der Klasse und der helfenden Aufpasser erforderlich ist. Ein Wechsel der Rollen von Blinden und Führern ist sinnvoll.
Nach Abschluss dieses Experiments, wenn beide Gruppen die Augenbinden abgelegt haben, sollten die Schüler keine Möglichkeit bekommen, sich auszutauschen, sondern sollten möglichst vereinzelt bleiben (auseinandersetzen). Es beginnt eine Phase des kreativen Schreibens. Hierfür bekommen die Schülerinnen und Schüler einzeln Arbeitsaufträge in einem Umschlag überreicht. Dass es sich um unterschiedliche Arbeitsaufträge handelt, weiß zu diesem Zeitpunkt nur die Lehrkraft:
Die Schülerinnen und Schüler lesen anschließend ihre Texte vor. Die Lehrkraft muss hierbei darauf achten, dass Texte zu unterschiedlichen Arbeitsaufträgen gelesen werden – was den Schülerinnen und Schülern aber noch immer nicht bekannt ist. Sie werden beim Zuhören bemerken, dass manche ihrer Klassenkameraden ganz anders mit der Blindheit umgehen als sie selbst. Erst im Austausch über die Texte entdecken die Schüler, dass sie unterschiedliche Arbeitsaufträge haben. Sie erkennen so, wie viel der Glaube an Gott und an seine Fähigkeit, Wunder zu tun, am Leben verändern kann.
Eine „Blitzlichtrunde“ (jeder Schüler sagt einen Satz) darüber, welcher Blinde das beste Leben führen wird und warum, kann die Unterrichtseinheit abschließen
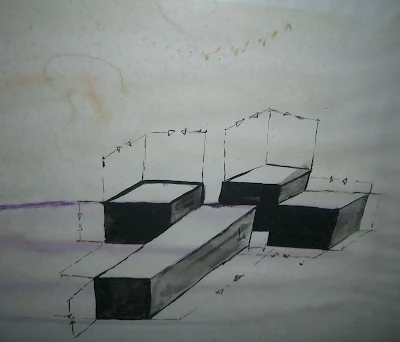
Kommentare
Kommentar veröffentlichen